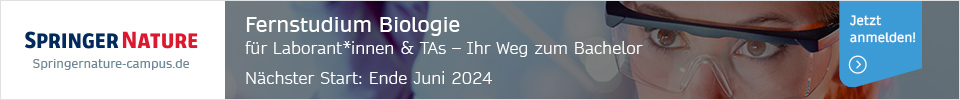In unserem Schwestermagazin Labtimes hat einer unserer Autoren hierzu letztes Jahr einen Beitrag verfasst (Ausgabe 3-2014 ab Seite 38). Darin verweist er auf mögliche Interessenskonflikte. Einige Wissenschaftler, die zur Giftigkeit industriell genutzter Substanzen forschen, bekommen nämlich Geld aus der Industrie. Erwähnt ist auch ein Review-Artikel, an dem Sie beteiligt waren. Nämlich zur Toxizität von Bisphenol A – Ihren Schlussfolgerungen nach in unserem Alltag eine unproblematische Substanz (Crit Rev Toxicol. 2011 Apr;41(4):263-91). Hat Sie geärgert, dass Ihr Name im Zusammenhang mit industriefreundlichen Forschern erwähnt wurde?
Hengstler: Wie der Artikel geschrieben war, fand ich stellenweise nicht okay. Was ich grundsätzlich schlecht finde, sind diese thought terminating clichés. Damit meine ich solche Klischees, bei denen man gar nicht mehr nachdenken muss, sobald sie vorgebracht werden.
Also wenn es um „die da oben“ oder „Geld aus der Wirtschaft“ geht?
Hengstler: Bei mir stimmt das ja gar nicht, ich habe noch nie einen Cent von der Industrie bekommen. In diesem Artikel in Labtimes wird aber ausgeführt, dass manche Toxikologen von der chemischen, pharmazeutischen oder Tabakindustrie Geld bekommen und deswegen so urteilen, wie die Industrie das gerne hätte. Direkt danach folgen unter der Überschrift „Experten, die der Industrie dienen“ kritische Ausführungen zu einzelnen Personen, auch zu mir. Da entsteht der Eindruck, ich wäre ein gekaufter Wissenschaftler. Das ist das Persönliche, wogegen ich mich wehren wollte. Nachdem ich diese Unterstellung kritisiert hatte, hat mich die Redaktion aber fair behandelt und mir Gelegenheit gegeben, darauf zu antworten.
Eine zweite Sache liegt mir aber auch am Herzen: Nur weil jemand eine Befangenheit hat, muss ich deswegen seine Argumente nicht mehr ernst nehmen? Das finde ich wirklich übel, denn es kann ja sein, dass jemand zwar Geld von der Industrie angenommen hat und in einem Interessenskonflikt steht, aber dass seine Argumente trotzdem richtig sind!
Grundsätzlich ist es aber doch schon der Fall, dass eine befangene Person eher dessen Lied singt, wessen Brot sie isst. Davon kann sich sicher niemand freisprechen.
Hengstler: Darum muss man Interessen und Interessenskonflikte unbedingt offenlegen. Was mich aber stört ist, wenn angebliche oder auch echte Befangenheiten als Totschlagargument ins Feld geführt werden, um sich nun nicht mehr mit den Sachargumenten der kritisierten Person auseinandersetzen zu müssen. Beim Bisphenol A war das in unserem Review eigentlich eine recht trockene und unspektakuläre Risikobewertung mit einem klaren Ergebnis. Und auf einmal sind da etliche Journalisten und Blogs, die negativ darüber schreiben. Dagegen kommt man gar nicht an. Wenn man jetzt aber ein bisschen im Internet surft, stellt man fest, dass die alle untereinander vernetzt sind und teilweise für die gleichen NGOs arbeiten. Da stecken doch sicher auch Interessen dahinter!
Inwiefern?
Hengstler: Es gibt zum Beispiel Alternativen zum Bisphenol A, wie Bisphenol S, wo einfach noch Schwefel drin gebunden ist. Und diese Produkte werden dann als ‚Bisphenol-A-frei’ deklariert. Aber im Vergleich zum Bisphenol A ist das Bisphenol S viel weniger untersucht. Da können wir gar nicht wissen, was besser ist. Und ich vermute, dass dahinter auch ein Marketing-Argument stehen könnte, wenn man die eine Substanz schlecht macht.
Dann kommen wir mal zu den Sachargumenten. Wann sind wir diesem Bisphenol A denn überhaupt ausgesetzt?
Hengstler: Überall, wo Plastik vorkommt, wie in Plastiktrinkflaschen, Computertastaturen, aber auch bestimmten Papierarten. Bisphenol A wird zur Synthese von Kunststofffen eingesetzt, und als Antioxidans.
Und welche Gefahren birgt Bisphenol A?
Hengstler: Bisphenol A aktiviert den Östrogen-Rezeptor, und ab einer bestimmten Exposition wird das ganz sicher problematisch. Der Vergleich von Dosen im Tierversuch mit noch keinem Effekt und Expositionshöhe im Menschen ist ein allgemein übliches Vorgehen für die Risikoabschätzung: Man bestimmt in Tierversuchen die Dosis, in Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, ab der toxikologische Effekte auftreten und ermittelt die nächstniedrige Dosis als „Dosis ohne Effekt“. Dann schaut man: Wie viel bekommt der Mensch ab? Welche Konzentrationen treten im menschlichen Organismus auf? Das ist der margin of exposure.
Für Bisphenol A ist dieser margin of exposure deutlich größer als der erforderliche Sicherheitsabstand. Vereinfacht gesagt liegt dieser Sicherheitsabstand etwa beim Faktor 100. Beim Bisphenol A liegt er, je nach Studie, zwischen dem Faktor 200 und 10.000.
Demnach würden ja selbst die pessimistischsten Studien immer noch zu dem Schluss kommen, dass Bisphenol A den Mindeststandard mehr als erfüllt. Wie ist denn Ihr Eindruck beim Risikoempfinden, wenn es um chemische Verbindungen geht. Neigen wir dazu, Gefahren irrational zu überschätzen und andere Risiken dafür zu vernachlässigen?
Hengstler: Ja, die Risikowahrnehmung und das tatsächliche Risiko gehen manchmal weit auseinander. Während Bisphenol A sehr gut untersucht ist und der Abstand zwischen Exposition und der problematischen Konzentration ausreichend groß ist, gibt es viele Substanzen, die man unterschätzt. Zum Beispiel Arsen. Durch epidemiologische Studien kann man beim Arsen abschätzen, ab welcher Exposition es zu einem erhöhten Krebsrisiko kommt. Eine Erhöhung des Tumorrisikos um 1 Prozent wird zwischen 0,3 und 8 µg Arsen pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag angenommen. Arsen kommt in vielen Nahrungsmitteln vor, wie beispielsweise Getreide- und Milchprodukten oder Reis. Wir nehmen etwa 0,6 bis 2 µg pro Kilogramm Körpergewicht am Tag auf und überschreiten somit die untere Grenze. Darin sehe ich jetzt zwar keinen Grund zur Panik, das ist sicher nicht so kritisch wie damals Asbest. Aber es ist eine Substanz in der Grauzone, die mit großer Wahrscheinlichkeit zu unserem Hintergrund-Krebsrisiko beiträgt.
Sie haben schon erwähnt, dass das Gefahrenpotential experimentell ermitteln muss. Dabei kommt man momentan nicht um Tierversuche herum. Aber Sie arbeiten auch an Zellkultursystemen. Warum können diese in vitro-Modelle bislang noch nicht Tierversuche komplett ersetzen?
Hengstler: Eine Zelle, die in vitro wächst, ist nur gegenüber einer Konzentration exponiert. Die hat ja keine orale Aufnahme, keine renale Ausscheidung und keine Pharmakokinetik. Deswegen sind diese Modelle noch ungenau.
Kann man denn mit Hilfe von in vitro-Systemen zumindest schon mal die „bösen Buben“ aussortieren, bevor man in die Tierversuche geht?
Hengstler: Genau das ist die Stärke der in vitro-Systeme. Ein Beispiel: Eine Substanz kompromittiert die in vitro-Funktion von Nervenzellen schon bei einer niedrigen Konzentration von einem Mikromolar. Und gleichzeitig überwindet sie die Blut-Hirnschranke. Dann ist ganz klar: Menschen sollten diese Substanz nicht in dieser Größenordnung abbekommen, weil man sonst mit Neurotoxizität rechnen muss. Solche Vorscreenings werden zunehmend gemacht, einfach weil es auch preisgünstiger ist. Damit scheidet man Substanzen aus, die ziemlich sicher im Tierversuch rausfallen würden.
Ihr Team hat ein Analyse-System auf einem Chip entwickelt, auf dem Zellkulturen als dreidimensionale Sphäroide in einem Tropfen wachsen. Nun sind diese „hanging drop“-Systeme nicht neu. Was ist das Besondere an Ihrer Entwicklung?
Hengstler: Sphäroidkulturen gibt es schon lange, das stimmt. Wenn man aber die Kommunikation zwischen verschiedenen Organen testen will, zum Beispiel zwischen Leber und Niere, dann war das bisher schwierig. Herkömmlich würde man die Substanz auf ein Leberzell-Sphäroid geben, dann überträgt man den Überstand des Kulturmediums auf Nierenzellen. Aber viele Metabolite sind relativ kurzlebig. Auf dem Microfluid-Chip kann man unterschiedliche Sphäroide gleichzeitig kultivieren, die über einen laminaren Flüssigkeitsstrom miteinander verbunden sind. Dadurch können Metabolite innerhalb von Sekundenbruchteilen von einem Mikrogewebe in ein anderes gelangen. So können wir steuern, ob sie zuerst durch ein Leber-Sphäroid, also eine Art Minileber, laufen, und nach einer bestimmten Zeit die Niere oder einen Tumor erreichen. Wir können also Organ zu Organ-Kommunikation simulieren. (Nat Commun. 2014 Jun 30;5:4250).
Also ein Kompromiss zwischen einer leicht zu handhabenden Zellkultur und einem vollständigen Organismus.
Hengstler: Genau, in bestimmten Aspekten kommen wir der in vivo-Situation näher. Wobei man aber vorsichtig sein muss. Es ist keinesfalls garantiert, dass sich zum Beispiel eine Leberzelle in der Kultur genauso verhält wie im Organ. Oft werden dann hunderte Gene rauf und runter reguliert. Deshalb sind auch genomweite Expressionsanalysen wichtig, um zu verstehen, in welchen Aspekten die Zellen sich ähnlich verhalten wie im lebenden System und wo man vorsichtig sein muss.
Ihre Experimente klingen eher nach Medikamentenforschung als nach Arbeitsschutz.
Hengstler: Auch wenn wir „Leibniz-Institut für Arbeitsforschung“ heißen, erforschen wir Toxikologie in der gesamten Breite und berücksichtigen das gesamte chemische Universum. Wir brauchen detaillierte Einblicke in molekulare Mechanismen, damit wir die Interaktion von Chemikalien mit biologischen Systemen verstehen. Und wenn wir das alles einbeziehen, können wir auch Chemikalien am Arbeitsplatz genauer bewerten.
Ich frage deshalb, weil es in vielen Ihrer Arbeiten um Vorgänge in der Leber geht. Und da denke ich vor allem an Substanzen, die man oral aufnimmt, und weniger an solche, denen man bei der Arbeit ausgesetzt ist.
Hengstler: Es ist aber auch bei ganz vielen Substanzen aus der Arbeitswelt so, dass Leber- oder Nierentoxizität die für den Organismus sensitivste Stelle ist. Auch wenn man das nicht immer gleich erwarten würde. Die Leber ist nun einmal das zentrale Stoffwechselorgan, deswegen ist sie ein besonderer Schwerpunkt unserer Forschung.
Sie und Ihre Kollegen arbeiten auch an mathematischen Modellen, um vorherzusagen, was Gifte im Körper anstellen. Wird es irgendwann möglich sein, dass man eine Strukturformel in den Computer gibt, und der sagt einem dann, in welchen Organen und ab welchen Konzentrationen diese Substanz Schäden anrichtet?
Hengstler: Struktur-Aktivitäts-Vorhersagesysteme gibt es bereits, die zumindest eine grobe Abschätzung vornehmen. Diese Simulationen sind immer nur so gut wie die Datenbasis. Bis das wirklich zufriedenstellend funktioniert, wird noch viel Zeit vergehen. Doch die mathematische Modellierung hat schon einiges geleistet, um komplexe Situationen zu verstehen.
Haben Sie dafür ein Beispiel?
Hengstler: Wenn eine Substanz für die Leber toxisch ist, kommt es oft zu Nekrosen. Dann proliferieren die überlebenden Zellen, so dass sie in relativ kurzer Zeit diese Lücken wieder perfekt schließen. In der Maus dauert das sechs bis acht Tage. Doch in manchen Situationen scheitert diese perfekte Regeneration. Dann erst kommt es zu den ernsten Toxizitäten wie Leberzirrhose und Fibrose. Jetzt kann man ein räumliches Modell erstellen, in dem man die 3D-Position jeder einzelnen Zelle kennt. Dann programmiert man Verhaltenprinzipien der einzelnen Zellen, lässt diese Regeln ablaufen und sieht, was passiert.
Das heißt, Sie können schauen, unter welchen Bedingungen die Simulation dann die Leber regeneriert und was dazu notwendig ist. Was kommt denn dabei heraus?
Hengstler: Wir haben das schon vor einigen Jahren gemacht (Proc Natl Acad Sci U S A. 2010 Jun 8;107(23):10371-6). Das Ergebnis hätten wir so nicht erwartet. Nämlich, dass die Endothelzellen in kleinen Blutgefäßen der Leber, den Sinusoiden, diesen komplexen Regenerationsprozess steuern. So gibt das Modell Hinweise, wo man am besten weitersucht, zum Beispiel mit Knockouts in sinusoidalen Endothelzellen.
In einem Paper, das demnächst im Journal of Hepatology erscheinen soll, verwenden Sie dieses Modell, um den Abbau von giftigem Ammoniak in lebergeschädigten Mäusen vorherzusagen.
Hengstler: Ja, denn wenn die Leber geschädigt ist, steigt Ammoniak an. Schlimmstenfalls kann der Patient ins Koma fallen und sterben.
Nun haben Sie die Voraussagen Ihres Lebermodells im Tierversuch getestet. Eigentlich sollte das Ammoniak bei geschädigter Leber mehr akkumulieren. Aber im Tierversuch wurde es besser abgebaut als vorhergesagt. Ihr Modell lieferte also falsche Voraussagen. Ist das nicht frustrierend?
Hengstler: Ja und nein. Das Schöne ist doch: Wir konnten zeigen, dass das Lehrbuchwissen die echte Situation nicht genau genug erklären kann. Jetzt sehen wir ein unerwartetes Ergebnis im Tierversuch und können dafür wieder 15 oder 20 Ideen einbringen, die das erklären. Anstatt jede Idee im Tierversuch zu testen, passen wir das Modell an und sehen, was funktioniert und was nicht. Da bleiben meist nur wenige Möglichkeiten übrig.
Was kam bei Ihrer aktuellen Arbeit heraus? Warum wurde Ammoniak trotzdem abgebaut?
Hengstler: Weil ein bestimmtes Enzym, Glutamatdehydrogenase, in der geschädigten Leber ab einem bestimmten Stadium beginnt, Ammoniak zu entgiften – was es in dieser Weise in der gesunden Leber nicht tut. Das Schöne dabei: Wenn wir den lebergeschädigten Mäusen Glutamatdehydrogenase mit ihrem Substrat alpha-Ketoglutarat infundieren, können zu hohe Ammoniakkonzentrationen normalisiert werden.
Also könnte man damit irgendwann auch Patienten mit Leberschäden über den Berg helfen?
Hengstler: Das sind die nächsten Überlegungen. Doch für eine Weiterentwicklung in Richtung Klinik müssen wir noch interessierte Partner finden.
Interview: Mario Rembold
Foto: Leibniz-Institut
Letzte Änderungen: 02.02.2016