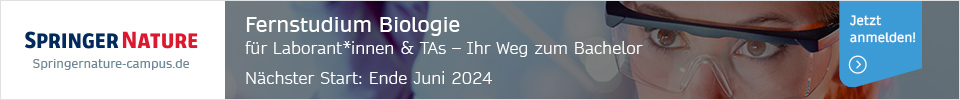Zum Peer-Review-System
„Seit meinem ersten eingereichten Paper im Jahr 1996 hat sich der Review-Prozess bereits stark verändert – und er wird sich in der näheren Zukunft wohl noch weiter verändern. Dennoch glaube ich nicht, dass grundsätzlich drastische Maßnahmen ergriffen werden sollten; das Peer-Review-System wird wahrscheinlich sowieso ganz von alleine angemessenere und zeitgemäßere Verfahrensweisen entwickeln. Web-basierte Manuskript-Einreichung und -Veröffentlichung werden die einzelnen Schritte sicher noch weiter vereinfachen und beschleunigen – abgesehen von einem: die tatsächliche Beurteilung durch die Gutachter. Ich denke dennoch nicht, dass dazu eine spezielle Ausbildung erforderlich ist; ein PI sollte schließlich sowieso sehr genau wissen, wie eine wissenschaftliche Story zu bewerten ist. Zudem wird das Problem, dass die Gutachter manchmal übertrieben kritisch sind (vor allem bei den sogenannten „High Impact Journals“) oder in anderen Fällen eher schlampig, wahrscheinlich bestehen bleiben. Ebenso wird die Auffassung, dass einige Zeitschriften attraktiver sind als andere, schwer aus der Welt zu schaffen sein. Aber das Hauptproblem liegt ja sowieso auf Seiten der Interpretation – etwa bezüglich der Frage: Wie identifizieren wir exzellente Forscher? Ich denke, langsam dämmert es jedem, dass die Erstellung von h-Indizes oder – schlimmer noch – das reine Aufzählen von Cell-, Science- und Nature-Papern sehr faule Wege ist, um Kandidaten für Professuren zu beurteilen oder Antragsteller zu bewerten.
Trotzdem erwarte ich, dass jenseits der etablierten Journals viele neue Wege entstehen werden, auf denen ich über meine Forschung berichten kann – wie etwa in Blogs oder Online-Diskussionsforen, in denen die Leute ihre positiven und negativen Erfahrungen und Experimente weltweit mitteilen. Wer weiß, vielleicht wird in Zukunft gar derjenige als erfolgreicher Wissenschaftler gelten, der viele „Likes“ auf einer Art speziellem Wissenschafts-Facebook bekommt? Ich werde da allerdings sicher nicht mehr dazugehören, da ich doch eher die altmodischen Kommunikationsformen bevorzuge...“
Zu Open Access
„Ich bin ziemlich sicher, dass Forschungskommunikation bald hauptsächlich über andere Kanäle als über die bekannten Verlage stattfinden wird, ob digital oder nicht. Das wird sehr wahrscheinlich eine traurige Entwicklung für diese Organe, die ja im ganzen letzten Jahrhundert so absolut zentral waren. Wenn sie aber kooperativ handeln, können sie diesen Prozess möglicherweise noch um das eine oder andere Jahrzehnt hinauszögern. Je mehr vernünftige Angebote sie beispielsweise zu bezahlbaren Preisen machen – gerade mit Blick auf die Universitäten und ihren begrenzten Budgets –, umso besser sind sicher ihre Perspektiven, um länger relevant zu bleiben.“
Zur Gleichstellung der Geschlechter
„Es wird länger als zehn oder zwanzig Jahren dauern, die „Kultur“ der Diskriminierung von Frauen umzukehren, die Jahrtausende lang auf der ganzen Welt bestand (und in den meisten Teilen auch heute noch gültig ist!). Wahrscheinlich müssen wir den Menschen mehr Zeit geben sich anzupassen – nicht nur in ihrem rationalen Denken, sondern auch in ihren Lebensweise und Traditionen. Idealerweise sollten schlichtweg die hellsten Köpfe die Führungspositionen in der Wissenschaft besetzen, und nicht die lautesten Stimmen oder die stärksten Ellenbogen. Dummerweise sind aber nur die wenigsten Köpfe wirklich frei – ja viele wollen es gar nicht mal wirklich sein. Dies ist das größte Hindernis für echte Gleichstellung. Ganz allgemein sollten wir daher junge Menschen, und insbesondere Frauen, besser zu dieser sehr speziellen Fähigkeit erziehen, eine freien und unabhängigen Geist zu entwickeln. Und warum haben wir abgesehen davon nicht ein bisschen mehr Geduld? Wir sind doch schon sehr weit gekommen – wenn ich etwa nur vergleiche, wie die Situation jetzt ist und wie es damals für mich als Student war. Wir können stolz sein auf diese Entwicklung. Und wenn wir dazu noch optimistisch und selbstbewusst bleiben, dann ist das das beste Rüstzeug für die Zukunft.
Ich persönlich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass ich in Bezug auf meine Forschung oder meine Karriere andere Entscheidungen getroffen hätte, wenn ich ein Mann wäre. Meine Karriere war sowieso ganz und gar nicht frauenspezifisch. Die Unterschiede in meinem Privatleben wären sicherlich viel größer.“
Zur Wissenschaftskommunikation
„Ich muss zugeben, dass ich die Frage der Priorität einer Entdeckung für weniger wichtig für die Wissenschaft erachte. Sehr oft bekommt gerade nicht die erste Person, die etwas entdeckt oder erfasst hat, auch die meisten Lorbeeren dafür. Ebenso oder gar noch wichtiger ist das richtige Timing – andere müssen einfach zu schätzen wissen, was Sie tun –, und was Sie aus Ihrer Entdeckung machen. Gerade Dinge technisch besser oder gründlicher zu tun als andere, die eigentlich die ursprüngliche Idee hatten, hat am Ende viele Karrieren angeschoben.“
Zur Evaluation von Nachwuchsforschern
„Sicherlich ist das Rennen um Impact-Faktoren schädlich, und jeder weiß das. Die einzige gute Alternative ist, sich mehr Zeit zu nehmen, um sich die Menschen und ihre Arbeit wirklich anzuschauen. Umgekehrt ist daher eines der wichtigsten Merkmale, um als Jungwissenschaftler erfolgreich zu werden, die Fähigkeit, gut zu kommunizieren und die Aufmerksamkeit der anderen stetig und nachhaltig auf sich zu ziehen. Die Entscheidung, ob eine Story in einem High Impact-Journal landet, hängt ja auch sehr oft von der Art und Weise abhängt, wie sie erzählt ist. Gerade deswegen glaube ich auch nicht, dass das derzeitige System zu viel Voreingenommenheit gegenüber anderen, umfassenderen Möglichkeiten der Evaluation erzeugt.“
Alejandrolvido
(Das Interview erschien zuerst auf Englisch in Lab Times 4/2016 auf Seite 38)