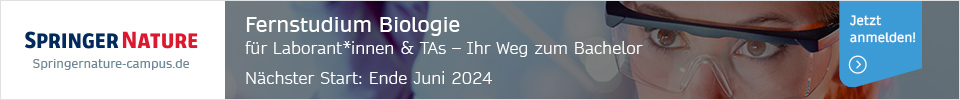Markus Göker: Wenn wir verstehen wollen, warum die Organismen heute so sind, wie sie sind, dann müssen wir ihre Evolution betrachten. Darüber kann man zumindest teilweise ganz allgemeine Fragen beantworten, wie zum Beispiel: Warum gibt es eine bestimmte Gruppe von Bakterien oder Archaeen? Warum ist diese oder jene Gruppe besonders erfolgreich? Und warum entwickeln sich innerhalb mancher Gruppen humanpathogene Krankheitserreger und in anderen nicht? Dazu muss man deren Evolution studieren. Das kann man sich zum einen auf Ebene der Makroevolution anschauen – was wir meistens tun. Man kann aber auch auf der Ebene der Mikroevolution ansetzen, um herauszufinden, was innerhalb einzelner Arten geschieht. Und da ist eine ganz wichtige Frage natürlich, wie Antibiotika-Resistenzen entstehen. Solche Studien finden auch an der DSMZ statt.
Trotz horizontalem Gentransfer lassen sich zuverlässige Stammbäume rekonstruieren
Die mikrobielle Welt bietet ja einen unerschöpflicher Vorrat an Substanzen, die medizinisches oder technologisches Potential haben. Sind Sie auch daran interessiert?
Göker: Ja, natürlich. Die sogenannten GEBA- und KMG-Projekte setzen bei uns starke Schwerpunkte. GEBA steht für Genomic Encyclopedia of Bacteria and Archaea, und KMG für 1.000 Microbial Genomes, wobei das ‚K’ für die Tausend steht. Das KMG-Projekt hatte mehrere Phasen, jeweils mit rund eintausend Genomen. Unser Projektpartner ist hierbei das Joint Genome Institut (JGI) in Kalifornien. Die Leute dort haben ein sehr starkes Interesse daran, biosynthetische Cluster in diesen Genomen zu detektieren und zu charakterisieren, um diese dann auch in Produktivstämme einzubringen.
Aus diesem KMG-Projekt ist unter anderem eine Arbeit hervorgegangen, die dieses Jahr in Nature Biotechnology erschienen ist (35: 676-83). Darin stellen Sie neben phylogenetischen Analysen auch neu entdeckte Proteinfamilien vor. Kommt man über die Analyse solcher biosynthetischer Cluster ausschließlich an Proteine und Peptide heran, oder kann man anhand der Genomdaten auch komplexere Synthesewege rekonstruieren? Es gibt ja auch niedermolekulare Substanzen mit interessanten Eigenschaften, die aber nicht direkt im Genom kodiert sind, sondern erst über Enzyme synthetisiert werden!
Göker: Da ist man heute relativ weit. Ich würde nicht sagen, dass das Ganze schon perfekt ist, aber es funktioniert zumindest teilweise. Unter anderem hängt das von der Bakteriengruppe ab. Schon allein die Anzahl der Gene, die wir in einem Genom überhaupt annotieren können, schwankt relativ stark zwischen verschiedenen Bakteriengruppen. Schließlich verwendet man für die bioinformatische Detektion ja im wesentlichen Sequenzähnlichkeit. Dafür brauchen wir aber gefüllte Datenbanken, in denen bereits Sequenzen und Gene charakterisiert sind. Erst dann können wir die Verbindung von biochemisch bereits charakterisierten Enzymen und Genen hin zu solchen herstellen, die noch unbekannt sind. Daher kann man logischerweise solche Verbindungen zur biochemischen Information aus der Literatur je nach Gruppe mehr oder weniger gut herstellen. Wovon letztlich wiederum abhängt, welche Stoffwechselwege man vorhersagen kann.
Wenn wir aus Sicht eines Grundlagenforschers auf mikrobielle Stammbäume schauen: Wie kann man hier überhaupt Arten definieren? Zwischen unterschiedlichen Bakterienspezies fand und findet ja offenbar weitaus häufiger horizontaler Gentransfer statt, als man bis vor Kurzem annahm. Sind eindeutige Stammbäume dann überhaupt möglich und sinnvoll?
Göker: Diesen Punkt hat man vor fünf bis zehn Jahren intensiv in der Literatur diskutiert. Formal benutzen wir für Bakterien und Archaeen ja immer noch die Klassifikation nach Carl von Linné und reden von Arten, Gattungen, Familien und Ordnungen. Als Anhänger der phylogenetischen Systematik verstehe ich die Klassifikation als eine Zusammenfassung der Phylogenie. Wäre jetzt der horizontale Gentransfer tatsächlich so ausgeprägt, dass man überhaupt keine Phylogenie rekonstruieren könnte, dann sollten wir diese Linnésche Klassifikation eigentlich auch nicht nutzen. Meiner Meinung nach haben wir aber trotz des horizontalen Gentransfers immer noch ein starkes phylogenetisches Signal und können zuverlässige Stammbäume rekonstruieren wie auch Taxon-Grenzen daraus ableiten. Letztendlich ermitteln wir Artgrenzen aus dem paarweisen Vergleich von Genomsequenzen. Für die Ähnlichkeit zwischen zwei Genomen definieren wir einen Grenzwert für die Art. Bakteriengenome sind damit quantitativ vergleichbar.
„Man sollte das biologische Artkonzept nicht überschätzen“
Ein solcher Grenzwert scheint mir erstmal recht willkürlich. Eigentlich ist eine Art ja definiert als eine Gemeinschaft von Lebewesen, die sich in der Natur untereinander paaren und fruchtbare Nachkommen hervorbringen können. Doch unter Mikroben, die sich nur durch Teilung vermehren, kann es demnach ja überhaupt keine Arten im strengen Sinne geben.
Göker: Natürlich sind mit unserem Artkonzept für Bakterien und Archaeen keine konkreten Vorstellungen zur sexuellen Fortpflanzung und zu populationsgenetischen Aspekten verbunden. Ich glaube aber, dass auch in der Zoologie und Botanik das biologische Artkonzept nicht die Rolle spielt, wie man sie in Lehrbüchern findet. Wenn dort Taxonomen eine neue Art beschreiben, testen sie ja auch nicht wirklich die Fortpflanzung. Man sollte also das biologische Artkonzept nicht überschätzen.

Sie selbst sind unter anderem an der Verwandtschaft innerhalb einer ganz konkreten Bakteriengruppe interessiert: Roseobacter. Ergebnisse hierzu haben Sie kürzlich im ISME Journal publiziert (11(6): 1483-99): Die DFG fördert dieses Projekt schon seit 2010 im Rahmen eines Transregio-Sonderforschungsbereiches, in den auch andere deutsche Institute involviert sind. Das Projekt wurde schon einmal verlängert, und derzeit beantragen Sie eine dritte Projektphase. Was macht ausgerechnet Roseobacter so interessant?
Göker: Diese Bakterien, die wir als Roseobacter-Gruppe zusammenfassen, haben wir ausgewählt, weil sie eine ökologisch wichtige Rolle in den Weltmeeren spielen. Darunter gibt es Vertreter, die mit Algen assoziiert sind und auch periodisch mit Algenblüten auftauchen und wieder verschwinden. Roseobacter kommen in hoher Anzahl vor, hat eine hohe Artenvielfalt und besiedelt unterschiedliche Habitate.
Ihre phylogenetischen Analysen bestätigen die Einordnung der Roseobacter-Arten in eine einzige taxonomische Gruppe?
Göker: Ja. Wir haben gesehen, dass diese Gruppe wahrscheinlich ursprünglich marin war. Allerdings haben sich verschiedene Untergruppen dann für ein Landleben entschieden. Wir konnten das auch anhand der der Genome nachvollziehen. Die an Land lebenden Arten haben bestimmte Stoffwechselwege verloren und andere Funktionen hinzugewonnen.
Im Paper nennen Sie unter anderem Natrium-Transporter sowie auch Synthesewege, die für die Osmoregulation wichtig sind. Also haben Sie nicht bloß Sequenzunterschiede verglichen, sondern können denen auch konkrete Funktionen zuordnen?
Göker: Ja, viele der Unterschiede können wir im Rahmen der Anpassung ans Wasser- oder Landleben sehr gut interpretieren.
Wie hat sich heute der Blick auf mikrobielle Stammbäume verändert?
Göker: Früher hat man gerade in der Taxonomie hauptsächlich die 16S rRNA herangezogen. Das ist allerdings nur ein Einzelgen, und die Stammbäume waren daher nicht so gut aufgelöst. Heute stehen uns komplette Genome zur Verfügung, um Verwandtschaftsverhältnisse zu berechnen. Viele bisherige Taxa stellen sich letztlich doch nicht als natürliche Gruppe heraus, wenn man sie anhand mehrerer Gene untersucht. Man erlebt also einige Überraschungen, und es wird sicher auch zu Neuklassifikationen von Mikroorganismen kommen. Ein weiterer Vorteil ist, dass man metagenomische Daten umso besser analysieren kann, je mehr Referenzstämme man durchsequenziert hat, die man genau kennt.
Interview: Mario Rembold
Letzte Änderungen: 02.11.2017