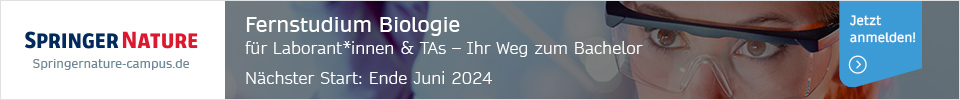Aminosäuren mit Mehrwert
(19.02.2018) Experimente zeigen, dass etwa die Hälfte der proteinogenen Aminosäuren ausreicht, um strukturell und funktionell intakte Proteine aufzubauen. Warum aber gibt es dann die andere Hälfte?
(19.02.2018) Der genetische Code, die universelle Bauanleitung für alle bekannten Proteine, besteht aus 20 – wenn man Selenocystein mitrechnet 21 – Aminosäuren. Warum aber genau diese sogenannten proteinogenen Aminosäuren aus der Fülle der in der Natur vorkommenden Aminosäuren in den genetischen Code aufgenommen wurden, ist eines der großen Rätsel der Entstehung des Lebens.
Sicherlich spielten Größe, Ladung und Hydrophobizität eine Rolle – Eigenschaften, anhand derer sich die proteinogenen Aminosäuren in verschiedene Gruppen einteilen lassen. Experimentell konnte jedoch gezeigt werden, dass gar nicht alle von ihnen benötigt werden, um eine stabile und funktionelle Proteinfaltung zu ermöglichen. Dafür reichen zwischen 7 und 13 Aminosäuren aus.
Im Laufe der Evolution tauchten zuerst einfach aufgebaute Aminosäuren wie Glycin und Alanin auf, während die komplexen aromatischen Aminosäuren später dazu kamen. Analysen der Kristallstrukturen der jeweiligen Aminoacyl-tRNA-Synthetasen legen sogar nahe, dass die beiden jüngsten Aminosäuren Tyrosin und Tryptophan erst in den genetischen Code integriert wurden, als sich bereits erste bakterielle Abstammungslinien verzweigten. Was aber brachten diese zusätzlichen Aminosäuren den frühen Lebensformen für einen Vorteil?
Quantenchemie erklärt genetischen Code
Wissenschaftler um Matthias Granold und Bernd Moosmann vom Institut für Pathobiochemie der Universität Mainz sind dieser Frage nun nachgegangen, indem sie sich die Quantenchemie der proteinogenen Aminosäuren angeschaut und diese dann mit der von abiotischen Aminosäuren aus Meteoriten sowie mit der von modernen Aminosäureabkömmlingen verglichen haben. Als Quantenchemie bezeichnet man die Anwendung der Quantenmechanik auf chemische Fragestellungen wie die Beschreibung der elektronischen Struktur von Atomen und Molekülen sowie deren Auswirkungen auf die Reaktionsfähigkeit. Als Maß für die Reaktivität (für Elektronentransfervorgänge, also Redox-Prozesse) bestimmten die Forscher die (Gesamt-)Orbitalenergie der Aminosäuren, bei der die Atomorbitale aller Atome des Moleküls gemeinsam betrachtet werden, und berechneten daraus die energetische Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten besetzten Orbital.
Aminosäuren als Radikalfänger
Die Analysen ergaben, dass alle späteren Aminosäuren wesentlich reaktiver waren als die ersten 13, vor allem gegenüber Peroxy- und anderen durch Sauerstoff induzierten Radikalen. Während die früh entstandenen, abiotischen Aminosäuren aus Meteoriten und dem berühmten „Ursuppen“-Experiment von Stanley Miller so hohe Differenzen ihrer Orbitalenergien und damit ebenso geringe Reaktivität aufwiesen wie die frühen Aminosäuren, zeigten sich Verbindungen wie Ubichinon, Plastochinon und Tocopherol ausgesprochen reaktiv. Letztere leiten sich von den drei aromatischen Aminosäuren Tyrosin, Tryptophan und Phenylalanin ab, werden im Gegensatz zu den Aminosäuren nur in Anwesenheit von Sauerstoff produziert und transferieren alle ein oder zwei Elektronen.
Könnten die späten Aminosäuren also möglicherweise als Redox-Cofaktoren in Proteine integriert worden sein? „Wir wissen, dass die Natur aus einer Struktur sauerstoffabhängig Hunderte von Molekülen gemacht hat, die überall in der Zelle Probleme lösen, die durch Sauerstoff entstehen. Dann ist es plausibel anzunehmen, dass auch der Urahn all dieser Moleküle, der als einziger schon ohne Sauerstoff hergestellt werden konnte, wegen derselben Eigenschaft erstmals in Proteine eingebaut wurde“, erklärt Moosmann. Die späten Aminosäuren waren wohl zuerst funktionslose Stoffwechselnebenprodukte und wurden erst wichtig, nachdem Sauerstoff in der Biosphäre auftauchte.
Die Integration der Radikalfänger in Proteine erklären die Forscher damit, dass vor allem die Lipide der Zellmembranen schutzbedürftig waren. Da freie Aminosäuren nicht in Membranen aufgenommen werden, half nur der Einbau in Proteine. Verpassten die Wissenschaftler Tyrosin und Tryptophan einen Membrananker, sammelten sich diese Varianten tatsächlich in Membranen und schützen dort vor radikal-induzierten Schäden. Zwei künstlich hergestellte, gegenüber Peroxy-Radikalen wenig reaktive Varianten von Tryptophan entfalteten dagegen keine Schutzwirkung.
Formbarer genetischer Code
Offensichtlich war der genetische Code nicht von Anfang an so, wie wir ihn heute kennen, sondern wurde durch den Anstieg von Sauerstoff in der Biosphäre noch einmal entscheidend verändert. „Die Aminosäuren müssen zuerst einmal existieren, meist als Nebenwege bei der Synthese der schon verwendeten Aminosäuren“, verdeutlicht Moosmann. „Die Umkodierung der Codons erfolgte dann durch manchmal nur kleine Veränderungen der tRNAs und/oder der Aminoacyl-tRNA-Synthetasen.“
Dazu liefert er gleich ein praktisches Beispiel: „Der Mensch hat in seinen Mitochondrien einen zweiten genetischen Code, dessen wichtigste Veränderung die Umkodierung des Codons AUA von Isoleucin nach Methionin ist. Diese Umkodierung hat zur Folge, dass der Mensch im Mitochondrium dreimal mehr Methionin akkumuliert als in cytosolischen Proteinen; die Atmungsketten-Proteinstrukturen sind dadurch auf der Oberfläche fundamental verändert. Diese Umkodierung wird höchstwahrscheinlich allein durch eine einzelne chemische Formylgruppe auf der mitochondrialen Met-tRNA bewirkt. Genetische Codes lassen sich also prinzipiell ganz leicht ändern, sofern nur die kodierten Proteine nicht leiden.“
Larissa Tetsch