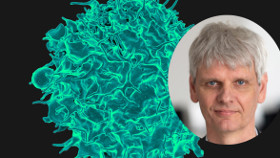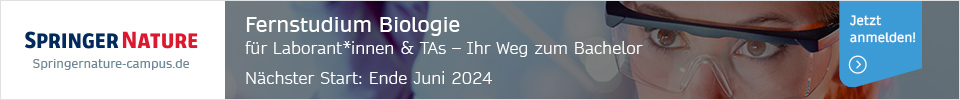Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze?
Buchholz: Bei den bisher zugelassenen gentherapeutischen Ansätzen, mit Ausnahme des kürzlich zugelassenen Casgevy, wird ein therapeutisches Gen in Form einer Genaddition zusätzlich zu dem vorhandenen Genom in Zellen des Patienten eingebracht. Mit CRISPR-Cas und weiteren Endonukleasen können wir nun die einer Erbkrankheit zugrunde liegende Mutation im Genom punktgenau reparieren. Wir können zudem im Genom Manipulationen vornehmen, welche die Genexpression verändern. So auch bei Casgevy zur Behandlung der Sichelzellanämie und der β-Thalassämie. Da bei jedem einzelnen Patienten unterschiedliche Mutationen im β-Globin-Gen krankheitsverursachend sind, schaltet man mithilfe von CRISPR-Cas in Stammzellen aus dem Knochenmark des Patienten die fötale Hämoglobin-Produktion durch Veränderungen der entsprechenden regulatorischen Sequenzen des BCL11A-Gens wieder an. So kann man verschiedenen Patienten das gleiche Therapeutikum verabreichen.
All diese zellbasierten Ansätze haben die Herausforderung eines sehr aufwendigen Herstellungsprozesses, oftmals für jede Person individuell. Das kann mit hohen Kosten und langen Wartezeiten verbunden sein. Hier liegt ein Vorteil der In-vivo-Gentherapie, bei welcher der Vektor als Arzneimittel universell für alle Patientinnen und Patienten eingesetzt werden kann. Allerdings sind die eingesetzten Vektoren ungerichtet und können nicht zwischen therapierelevanten und anderen Zellen im Organismus unterscheiden.
Welche gentherapeutischen Ansätze verfolgen Sie in Ihrer eigenen Forschungstätigkeit?
Buchholz: Ich beschäftige mich damit, wie man Vektorsysteme so gestalten kann, dass sie die therapierelevanten Zellen finden und die gewünschten Gene nur in diese Zellen einbringen, und das idealerweise nach systemischer Injektion. Die bisher für die Gentherapie zugelassenen Vektoren können nicht zwischen verschiedenen Zelltypen im menschlichen Organismus unterscheiden. Wenn sie systemisch gegeben werden, landen sie über die Blutzirkulation vor allem in der Leber. Dies ist günstig bei Erkrankungen, die Zellen der Leber betreffen. Ein Beispiel sind Gerinnungsstörungen aufgrund von defektem Faktor VIII oder Faktor IX. Bei anderen Erkrankungen müssen ganz andere Zelltypen angegangen werden, wie beispielsweise bei Krebs die Tumorzellen selbst oder gegen diese gerichtete T-Zellen im Rahmen einer Immuntherapie.
Welche Erfolge konnten Sie erzielen?
Buchholz: Wir konnten T-Zell-spezifische lentivirale Vektoren generieren, mit denen wir im Tiermodell CAR-T-Zellen nach Injektion direkt im Organismus herstellen können, also in vivo (EMBO Mol Med, 10(11): e9158). Auf der Oberfläche der lentiviralen Vektoren haben wir Rezeptorbindungsstrukturen eingebracht, welche die Genvektoren zu den T-Zellen leiten. Das sind zum einen hochaffine rekombinante Antikörper, in denen die schwere und leichte Kette miteinander fusioniert sind, sogenannte Single Chain Variable Fragments. Zum anderen sind es speziell entwickelte Designed Ankyrin Repeat Proteins (DARPins). Sie sind gegen CD8 auf zytotoxischen T-Zellen gerichtet. Wir haben zudem Vektoren hergestellt, die an CD3 und CD4 auf T-Zellen binden (Oncoimmunology, 8(12):e1671761; Blood Adv, 4(22):5702-15 und Mol Ther, 28(8):1783-94).
Die Lentiviren mit der Information für einen chimären Antigenrezeptor werden in das Genom der Zielzellen integriert und somit auch an die Nachkommen der CAR-T-Zellen weitergegeben. Sobald die Tumorzellen eliminiert sind, lässt die Proliferation der CAR-T-Zellen nach und ihr Spiegel sinkt. Es verbleiben aber noch CAR-T-Zellen im Organismus im Falle, dass der Tumor wieder auftritt. In Mäusen, die menschliche Tumore und fremde, menschliche T-Zellen tragen, sind nach Injektion unserer Vektoren innerhalb von ein bis zwei Wochen CAR-T-Zellen entstanden und die Tumore wurden eliminiert. Die CAR-Expression konnte dabei nur in den angesteuerten T-Zell-Typen nachgewiesen werden, also in CD8-positiven T-Zellen mit dem CD8-targetierten Vektor und in CD4-positiven T-Zellen mit dem CD4-targetierten Vektor.
Welche weiteren Untersuchungen sind nötig, bevor diese Therapie in Patienten angewendet werden kann?
Buchholz: Unsere Forschung endet im präklinischen Bereich. Um den In-vivo-CAR-T-Zell-Ansatz in die Klinik zu bringen, sind sicher eine Reihe weiterer präklinischer Untersuchungen notwendig, die im Detail von dem genauen Design des Vektors abhängen werden. Unter anderem wäre eine Erprobung des In-vivo-CAR-T-Zell-Konzepts im Großtiermodell sinnvoll. Biotechfirmen, vor allem in den USA, berichteten kürzlich, dass im Affenmodell erfolgreich In-vivo-CAR-T-Zellen hergestellt werden konnten. Die Ergebnisse wurden auf dem letzten Kongress der American Society of Hematology (ASH) vorgestellt. Ein anderer Aspekt betrifft die Konditionierung der Patientinnen und Patienten. Bei der herkömmlichen CAR-T-Zell-Therapie mit in vitro hergestellten CAR-T-Zellen muss eine Lymphodepletion durchgeführt werden, damit die transplantierten CAR-T-Zellen gut anwachsen können. Diese Behandlung führt zu einer Immunsuppression, die etwa eine schnelle Immunreaktion gegen die CAR-T-Zellen verhindert. Bisher ist unklar, ob man beim In-vivo-Ansatz ebenfalls eine Lymphodepletion braucht. Das werden nur klinische Studien zeigen können.
Wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf bei Ihren gentherapeutischen Ansätzen?
Buchholz: Vorteilhaft wären Vektoren, die Zellen anhand von zwei oder mehr spezifischen Oberflächenantigenen erkennen, da therapierelevante Zellen oftmals nicht durch einen einzigen Oberflächenmarker definiert sind. Wir haben kürzlich AAV-Vektoren entwickelt, die im Capsid DARPins gegen zwei verschiedene Oberflächenantigene von HIV-Reservoirzellen, CD4 und CD32a, enthalten. Sie zeigten beim Gentransfer eine deutliche Präferenz für Zellen, die beide und nicht nur einen der Oberflächenrezeptoren tragen (Biomaterials, 303: 122399). Wenn sich dieser Ansatz auch für andere Zelltypen als tauglich erweisen würde, würde dies die Bandbreite der Möglichkeiten erheblich erweitern, um in vivo therapierelevante Zellen anzusteuern.
Welche weiteren Vorhaben werden Sie als Nächstes angehen?
Buchholz: Wir möchten untersuchen, ob sich weitere Zelltypen mit Vektoren ansteuern lassen, die zwei und mehr Oberflächenmarker auf den Zielzellen erkennen. Mit den bereits erzeugten Vektoren wollen wir herausfinden, ob sie HIV-Reservoirzellen, die aus Patientinnen und Patienten isoliert wurden, tatsächlich spezifisch targetieren. Zudem entwickeln wir Strategien, um den für virale Vektoren konzipierten spezifischen Gentransfer auf Lipidnanopartikel auszuweiten, die als nicht-viraler Vektor immer größere Bedeutung gewinnen. Schließlich sind wir dabei, im Rahmen der Sicherheitsforschung die Risiken sogenannter „Kurzzeit-CAR-T-Zellen“ insbesondere in Bezug auf das Zytokinfreisetzungssyndrom genauer unter die Lupe zu nehmen. Solche CAR-T-Zellen werden nicht mehr ein bis zwei Wochen in Kultur expandiert, sondern bereits ein bis zwei Tage nach Zugabe der Vektorpartikel in den Patienten injiziert. Wir arbeiten hierzu an einem Mausmodell und einem Zellkultursystem, um die Sicherheit der „Kurzzeit-CAR-T-Zellen“ mit herkömmlichen CAR-T-Zellen vergleichen zu können.
Das Gespräch führte Bettina Dupont
Christian Buchholz ist Leiter der Forschungsgruppe Molekulare Biotechnologie und Gentherapie am Paul-Ehrlich-Institut in Langen.
Bild: NIAID (T-Zelle, CC-BY 4.0 Deed) & Paul-Ehrlich-Institut/M. Reiss (Porträt)
Weitere Artikel zum Thema CAR-Therapie
- „Man braucht ein Team, dem man vertraut“
Sagen die MDC-Forscher Uta Höpken und Armin Rehm über die Gründung ihrer Firma CARTemis Therapeutics im umkämpften CAR-T-Zell-Markt.
- „Wackelpudding“ für die CAR-T-Zell-Therapie
Solide Tumore sind mit CAR-T-Zellen nur schwer zu erreichen. Außer mit einem Hydrogel, das die Zellen mobil, vital und an Ort und Stelle hält.
- Zelluläres Aufrüsten
Evelyn Ullrich entwickelt am Uniklinikum Frankfurt Immuntherapien gegen Krebs. Sie verrät uns, warum die CAR-Technologie so vielversprechend ist.