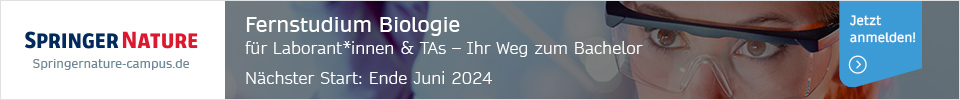Unter Räubern
(13.10.15) Das Modell "Publikation gegen Geld" hat auch räuberische Verleger hervorgebracht, die sich Qualitätskontrollen sparen. Forscher helfen bei den Raubzügen mit, wenn sie ihren Namen für solche Unternehmen hergeben.
Der britische Journalist und Blogger Richard Poynder hat einen radikalen Vorschlag veröffentlicht, wie man dem Wildwuchs der sogenannten predatory Open-Access-Verleger entgegenwirken könnte. Neben den räuberischen Journals selbst müssten auch deren akademische Editoren öffentlich an den Pranger gestellt werden. Forscher sollen so abgeschreckt werden, ihre Namen für wissenschaftsschädigende Abzocke herzugeben. Und ohne Aushängeschilder auf dem Editorial Board würde es den unseriösen Journalen schwer fallen, andere Wissenschaftler zu täuschen und sich an ihnen zu bereichern.
Das Phänomen der räuberischen Journals und Verlage ist eine Schattenseite der Open Access (OA)-Bewegung, die immer mehr auszuarten scheint. Denn mit dem Raub-Publizieren ist offenbar viel Geld zu verdienen.
Ob jemand die Artikel liest, ist sekundär
Anders als die traditionellen Titel, die abonniert und gekauft werden müssen, erscheint ein OA-Journal nur im Internet, die Artikel sind frei verfügbar. Daher entfallen für die Universitätsbibliotheken und Forschungsinstitute Kosten für Abonnements. Allerdings verlangen die meisten OA-Journale Publikationsgebühren von den Autoren. Einige Forschungseinrichtungen wie die Max-Planck-Gesellschaft übernehmen diese Gebühren mittlerweile komplett.
OA-Kritiker sehen darin einen Interessenskonflikt. Während einem traditionellen Journal wirtschaftlich daran gelegen ist, von möglichst vielen Lesern erworben zu werden, ist es das Interesse eines OA-Verlegers, möglichst viele zahlende Autoren aufzutreiben. Ob die Artikel auch jemand liest oder ob man sie überhaupt findet, das sei für das OA-Geschäftsmodell erst mal sekundär, monieren die Kritiker.
So entstanden auch die räuberischen Varianten der OA-Verlage. Die wissenschaftliche Qualität der Werke ist solchen Journalen vollkommen egal. Auch sinnlose, computer-generierte Texte mit Simpsons-Charakteren als Autoren werden hier und da umgehend akzeptiert. Ein ordentliches Peer Review wird oft nicht mal vorgetäuscht. Ein Experiment des US-amerikanischen Wissenschaftsjournalisten John Bohannon machte auf die Ausmaße des Problems aufmerksam. Er reichte einen komplett unwissenschaftlichen Text bei verschiedenen OA-Zeitschriften ein. Ein Großteil der getesteten Verlage akzeptierte den Artikel. Später führte Bohannon auch die Naivität der Medien vor, als er eine haltlose Pseudo-Studie über die angebliche Schlankheitswirkung der Schokolade in einem OA-Journal veröffentlichte. Der Artikel brachte es prompt zu weltweiter Berichterstattung.
Die Liste der Räuber
Jeffrey Beall, Universitätsbibliothekar an der University of Colorado in Denver, USA, beobachtet das Unwesen der predatory journals seit vielen Jahren. Beall's Liste führt penibel alle Journale und Verlage auf, die sich seiner Einschätzung nach nicht an die Regeln der guten wissenschaftlichen Publikationspraxis halten und keine ausreichenden Qualitätskontrollen eingeführt haben. Inzwischen sind dort knapp 700 zweifelhafte OA-Verlage aufgeführt. Seine Katalogisierung hat Beall zu einem Open-Access-Kritiker gemacht, er steht quasi im Dauerstreit mit der Bewegung. Die Liste der räuberischen Journals, obwohl sinnvoll und sachlich meist korrekt, wird von OA-Anhängern des Öfteren geschmäht und als kontraproduktiv zurückgewiesen.
Dass akademische Forschung dank OA frei verfügbar wird, ist an sich gut und wichtig. Es gibt zahlreiche hochwertige und weltweit angesehene OA-Journale, wie zum Beispiel diejenigen des PLOS-Verlags. Deren Stärke liegt auch darin, dass sie ein wissenschaftlich solides und respektables Editorial Board haben, dessen Mitglieder sich bei Qualitätssicherung und Betreuung der Manuskripte einbringen.
Wird ein neues Journal gegründet, schauen potentielle Autoren nämlich in der Regel zuerst, wer auf dem Editorial Board sitzt, bevor sie überhaupt daran denken, dort ein Manuskript einzureichen. Die Raub-Journals werben in ihren Spam-artigen Emails an die Forscher folglich oft mit einem augenscheinlich respektablen Editorial Board, voller Professoren, Direktoren und leitender Ärzte. Manchmal erkennt man den Namen eines international bekannten Kollegen. Und genau dies soll Vertrauen in die Qualität des Magazins wecken. Derart überzeugt, reichen nicht wenige Wissenschaftler ihre Studien und Übersichtsartikel bei einem Raubtier-Verleger ein, überweisen die Publikationsgebühr und freuen sich anschließend über die überraschend zügige und unproblematische Publikation. Den Artikel können sie dann stolz auf ihrem Lebenslauf vermerken.
Wissenschaftler sind nicht die unschuldigen Opfer
Genau da will Poynder, der selbst übrigens ein Open-Access-Verfechter ist, ansetzen. Er schlägt eine öffentliche Datenbank vor, die alle Namen der Forscher enthalten soll, die auf den Editorial Boards der bei Beall gelisteten Verlage sitzen; samt ihrer Institutszugehörigkeit und den Journal-Titeln, mit denen sie als Editoren assoziiert sind. Die betroffenen Wissenschaftler würden ihre Aktivitäten als Editor dann vielleicht besser kontrollieren. Forscher könnten so auch leichter entdecken, wenn ein predatory publisher ihren Namen heimlich, ohne Erlaubnis, als Aushängeschild für das Editorial Board verwendet (was des Öfteren passieren soll).
Poynder jedenfalls sieht die Wissenschaftler selbst in der Bringschuld. Er erklärte mir in einer Nachricht: „Predatory publishing wird als Phänomen gesehen, bei dem die Community von Akteuren von außerhalb beraubt wird“. Die räuberischen Journals seien aber nur imstande, so zu handeln, weil die Mitglieder der Community (die Forscher selbst) sich einverstanden erklärten, auf den Editorial Boards der Räuber zu sitzen. Und Wissenschaftler hätten oft nichts dagegen, selbst bei Raubverlagen zu publizieren. Sogar westliche Universitäten würden dies stillschweigend tolerieren, wenn sie für eine Begutachtung einen möglichst hohen Publikationsausstoß ihrer Akademiker vorweisen sollen.
Daher Poynders Fazit: Die Wissenschaftlergemeinschaft sei kein unschuldiges Opfer, sondern habe sich mit den Raubverlagen quasi verschworen. Er befürchtet gar, die Forscher hätten damit womöglich ihren „moralischen Kompass“ verloren. Poynder zufolge ist es längst an der Zeit, dass sich die Community der Verantwortung stellt und die „Nessel“ der Raubverlage ausreißt.
Poynder meint, man rede das Problem des räuberischen Verlagswesens in der westlichen Forschung klein und ordne es eher den Entwicklungsländern und deren Wissenschaftlern zu. Obwohl es auch zahlreiche Negativ-Beispiele aus der westlichen Welt gibt. Die Beall-gelistete und weltweit aktive OMICS-Gruppe zum Beispiel führt US-amerikanische Professoren als Editoren, auch solche von Eliteunis wie Harvard.
Nicht nur ein Problem in Entwicklungsländern
Aber selbst wenn Raub-Journals wirklich eine Art Lokalproblem wären: es wäre anmaßend, den Studenten in Indien, China, und Brasilien den Bedarf an Information abzusprechen. Sie haben jedes Recht zu wissen, welche ethischen Vorstellungen von Wissenschaft ihre eigenen Professoren haben, die bei räuberischen Journals als Editoren mitwirken. Es ist ja nicht so, dass asiatische, osteuropäische und südamerikanische Akademiker intellektuell damit überfordert wären, sich ein Journal etwas genauer anzuschauen, bevor sie dort als Editor beitreten. Zahlreiche ihrer Kollegen widmen sich der weniger dankbaren Aufgabe, nicht-räuberische nationale und kleinere internationale Wissenschaftsmagazine zu pflegen und für deren wissenschaftliche Qualität zu sorgen.
Es ist aus meiner Sicht Kolonialdenken, die Wissenschaft in den Entwicklungsländern als unverbesserlich schlecht zu sehen. Vielmehr sollte man den guten Wissenschaftlern dort helfen und Forscher anprangern, die Raubjournals unterstützen. Poynders Vorschlag halte ich jedenfalls für einen guten Ansatz um aufzuräumen, in den Entwicklungsländern wie auch bei uns im Westen.
Leonid Schneider
Illustration: (c) erego / Fotolia
Letzte Änderungen: 14.01.2016