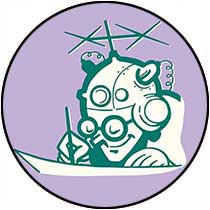Gene sind überschätzt...
Archiv: Schöne Biologie
Ralf Neumann
... – zumindest, wenn man sie ganz für sich und in ihrer Gesamtheit betrachtet.
Eigentlich war das schon klar, als sich herausstellte, dass sich in unseren Zellkernen gerade mal etwa 21.000 kodierende Gene tummeln. Sogar einige Einzeller haben mehr – beispielsweise Tetrahymena thermophila 27.000, Paramecium tetraurelia knapp 40.000 oder Trichomonas vaginalis gar fast 60.000.
Dass wir dennoch deutlich komplexer daherkommen, verdanken wir – wie wir mittlerweile wissen – vielmehr der Tatsache, dass wir absolute Weltmeister in der multiplen Nutzung unserer Gene sind. Durch alle möglichen Tricks und Kniffe machen unsere Zellen aus so manchem Gen zahlreiche verschiedene Produkte, die zuweilen auch ganz verschiedene Funktionen erfüllen.
Möglichst viele Gene zu haben, ist also ganz offensichtlich nicht das Nonplusultra. Dafür spricht auch ein anderer klarer Trend in der Evolution: Gene schnellstmöglich aus dem Genom zu schmeißen, wenn man sie nicht mehr braucht. Wir hatten schon viele Beispiele dafür an dieser Stelle: Organismen, die von der freien zur parasitären Lebensweise wechseln und ruckzuck jede Menge Gene für nun nicht mehr benötigte Stoffwechselwege eliminieren; oder Fische, die in dunkle Höhlen umziehen und zügig die Gene für Augenbildung und -ausstattung verlieren. Und auch das neueste Beispiel zeigt diesen Trend ganz klar: Nematoden, die irgendwann in der Evolution auf Zwittertum und Selbstbefruchtung umgestiegen sind und heute ganze 7.000 Gene weniger haben als ihre nähesten zweigeschlechtlichen Verwandten (Science 359:55-61).
Gene zu unterhalten scheint die Zelle einen hohen Preis zu kosten – sodass sie offenbar für jeden Einzelfall stetig kalkuliert, ob sich der Stoffwechsel-Aufwand tatsächlich lohnt. Und falls nicht: Ex und hopp!
Nach einem frischen Paper der beiden US-Biologen Kevin Simonin und Adam Roddy soll sogar der grandiose Siegeszug der Bedecktsamer beziehungsweise Angiospermen vor allem auf solch einer radikalen Genomverkleinerung beruhen (PLoS Biology 16(1): e2003706).
Das klingt erstmal paradox. Schließlich war das Auftauchen der ersten Angiospermen vor etwa 100 Millionen Jahren zunächst einmal dadurch geprägt, dass ihre Pflanzen-Vorfahren zuvor in mehreren Linien ihr komplettes Genom dupliziert hatten. Mit dieser enormen Masse an Extra-Genen waren sie plötzlich in der Lage, schnell und uneingeschränkt neue Funktionen zu entwickeln und sich ungewöhnlich breit zu diversifizieren. Der Nachteil war jedoch laut den Autoren, dass die große Menge an genetischem Material den Pflanzen auch umgehend eine enorme physiologische Last auflud. Umso höher war der Druck, ungebrauchte Sequenzen schnellstmöglich wieder zu entfernen. Konnten sie nicht schnell genug eine positive Kosten-Nutzen-Bilanz vorweisen, waren sie daher bald wieder weg.
Folgerichtig hatten die ersten Angiospermen nach den Analysen von Simonin und Roddy auch tatsächlich eher kleine Genome. Das ganze Verdoppeln und Ausmisten muss daher zuvor und innerhalb evolutionsgeschichtlich ziemlich kurzer Zeit vonstatten gegangen sein. Und dies offenbar mit klarem Vorteil für die besten „Ausmister“.
Die Autoren sehen explizit darin den entscheidenden Schlüssel für den Erfolg, dass die Angiospermen heute 90 Prozent aller Landpflanzen auf Erden ausmachen. Denn im Gegensatz zu den „Großgenom-Pflanzen“, von denen sie sich abspalteten, konnten sie mit weniger DNA damals auch kleinere Zellen produzieren. Was wiederum die Möglichkeit bot, mehr Zellen in die Blätter zu packen und deutlich effizientere Photosynthese zu betreiben.
Spätestens damit waren die Angiospermen klar im Vorteil. Und dies nur, weil sie radikal unnütze Gene rausgeschmissen hatten.
Letzte Änderungen: 07.12.2017